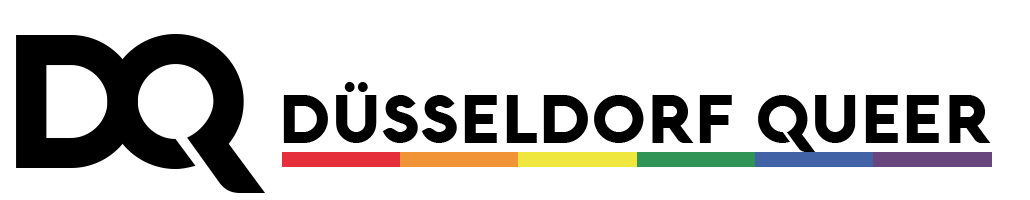Nach den erfolgreichen Rosa-Winkel-Stücken beschäftigt sich das Theaterkollektiv Düsseldrama auch in seinem neuen Stück „Kein Wort von uns“ mit den Lebensrealitäten queerer Menschen während der NS-Zeit. Düsseldorf Queer im Gespräch mit Autorin Simone Saftig.

Simone, nachdem die Rosa-Winkel-Trilogie in Zusammenarbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen entstanden ist, stammt euer neues Stück in Gänze aus deiner Feder. Warum habt ihr euch diesmal gegen einen Theaterworkshop entschieden?
Es war gar keine Entscheidung gegen einen Workshop, sondern für ein eigenständiges Theaterstück. Nachdem wir nun seit über einem Jahr zu dem Thema arbeiten, erschien es uns als folgerichtig, daraus jetzt ein Stück zu entwickeln – und als Dramatikerin ist es natürlich meine größte Freude, Theaterstücke zu schreiben. Das Schreiben ermöglicht mir auch, eine eigene künstlerische Auseinandersetzung, eine eigene Sprache und meine persönlichen Narrative zu dem Thema zu finden. Das ist für mich ein wichtiges Ventil, gerade bei so komplexen Themen.
Zielgruppe der neuen Produktion sind ebenfalls wieder Menschen ab 14 Jahren. Warum ist es euch so wichtig, dass sich junge Leute mit der Verfolgung homosexueller Menschen im Nationalsozialismus beschäftigen?
Wir mussten in unseren Workshops und mit Blick auf unsere eigenen Erfahrungen mit großem Entsetzen feststellen, dass die Geschichte des § 175 offensichtlich im Schulunterricht größtenteils nicht behandelt wird. Deswegen wollen wir mit unserem Theaterabend nicht nur ein Zeichen setzen, sondern auch eine klaffende Lücke füllen und mit den Mitteln der Kunst für Aufklärung sorgen.
Worum genau geht es in dem Stück „Kein Wort von uns“?
Es geht um die drei jugendlichen Protagonisten Kaspar, Wilhelm und Franz, die in den 30er Jahren in einem Lehrlingsheim in Krefeld leben und unterschiedlichen Ausbildungen nachgehen. Kaspar und Wilhelm sind seit Kindestagen beste Freunde und haben ihre ganz eigene Dynamik, die ins Wanken gerät, als sich eines Tages Franz in Kaspars Leben stiehlt. In Kaspar regen sich Gefühle für Franz und die beiden kommen sich näher. Natürlich geht es um den verheerenden Umstand, dass dieses Näherkommen unter absoluter Geheimhaltung passieren muss; es geht um die Repressalien der Nazis und die Verfolgung homosexueller Menschen nach § 175. Aber das Stück ist auch eine Coming-of-Age-Erzählung, die von Freundschaft und dem Erwachsenwerden in einem System erzählt, das keine Ausbrecher duldet. Es geht um die Fragilität einer gerade erst erwach(s)enden Verbindung zur eigenen Identität und der eigenen Lust. Kaspars Geschichte zeigt uns, wie zentral es gerade in jungen Jahren ist, sich frei entfalten und ausprobieren zu können ohne dafür verurteilt oder gar gejagt zu werden.
Bei „Allein im Rosa Winkel“ ging es um die Biografien von verfolgten queeren Personen aus Düsseldorf, jetzt spielt die Handlung in Krefeld. Ihr arbeitet ja auch unter anderem mit der dortigen NS-Dokumentationsstelle zusammen. Es gibt aber einen direkten Bezug zu Düsseldorf. Kannst du uns hierüber berichten?
Bei unseren Recherchen zu den Workshops haben der Regisseur Marvin Wittiber und ich viele Stunden im Landesarchiv NRW zugebracht und uns durch Gestapo-Akten gekämpft. Dabei sind wir immer wieder auf Verhörprotokolle von jungen Männern gestoßen, die in einem Lehrlingsheim in der Kruppstraße 110 wohnten – meinem heutigen Finanzamt Düsseldorf-Mitte. Insgesamt kamen in den Akten die Namen von 16 jungen Männern vor, die wegen Vergehen nach § 175 genannt wurden. Das hat mich nicht losgelassen und Fragen aufgeworfen. Da ich in der Nähe der Kruppstraße 110 wohne, bin ich eines Nachmittags hin und fand es irgendwie krass, an diesem Ort zu stehen, zu dem ich plötzlich eine ganze neue Verbindung hatte. Ich habe mir dann vorgestellt, welches Leben die jungen Männer vor rund 90 Jahren hinter diesen Mauern wohl geführt haben. Da wir sie nicht mehr fragen können, fand ich es spannend, ihre Geschichten zu imaginieren und mich dabei von echten Biografien inspirieren zu lassen. Und in den Täterdokumenten zwischen den Zeilen zu lesen, um auch die zarten Töne hörbar zu machen …
Für dein Stück „Modern Mermates“ hast du im vergangenen Jahr den Kieler Nachwuchs-Dramatiker*innen-Preis bekommen. Das Junge Theater Baden-Baden zeigt es zurzeit als Jugendstück. Und im Oktober wird dein Kinderstück „herzüberkopf“ am Theater Gießen uraufgeführt. Was fasziniert dich am jungen Theaterpublikum?
Als Zuschauerin berührt mich Kindertheater oft mehr als das sogenannte „Theater für Erwachsene“. Es sind die Aufführungen, in denen ich auch gelegentlich heule. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Vielleicht daran, dass Stücke für ein junges Publikum nicht so überintellektualisiert sind. Ich empfinde es immer als schöne Herausforderung, eine Sprache zu finden, die junge Menschen ernst nimmt, sie auf gar keinen Fall unterschätzt, aber gleichzeitig frei von akademischem Blabla und Theoriegepose ist.
Für die Premiere des neuen Stücks am 11. Oktober 2025 im Krefelder Südbahnhof wünschen wir toi, toi, toi! Was steht dann für Düsseldrama als Nächstes an?
Das nächste Projekt, an dem ich für Düsseldrama beteiligt bin, ist der letzte Teil unserer Rosa Winkel-Trilogie im Februar 2026. „Vor dem Rosa Winkel“ wird wieder ein Intensiv-Theaterworkshop mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, in dem wir uns der queeren Szene Düsseldorfs in der Weimarer Republik widmen. Die Abschlusspräsentation zeigen wir, wie bereits bei den letzten Teilen, im Theatermuseum Düsseldorf.
Fragen: Oliver Erdmann