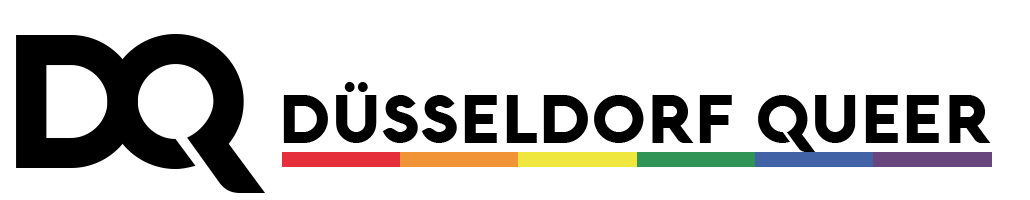Beim mittlerweile sechsten Podiumsgespräch zu queeren Themen im KAP1 ging es um „Queeres Gedenken – gestern und heute“. Im Talk mit Moderator Sascha Förster wurde ein Blick auf die Vielfalt der queeren Erinnerungskultur in Düsseldorf geworfen.

Am 21. Mai 2025 stand die Fortsetzung der Talkreihe „Queere Geschichte(n)“ auf dem Programm der Zentralbibliothek im KAP1. Queere Geschichte(n) Düsseldorf e.V. veranstaltet das Podiumsgespräch mit Moderator Dr. Sascha Förster (Institutsleiter TMD) in Kooperation mit dem Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung, der Zentralbibliothek und dem Theatermuseum Düsseldorf. Erneut waren die Reihen im Stadtfenster-Saal gut gefüllt.
Diesmal ging es um das Thema „Queeres Gedenken – gestern und heute“. Auf dem Podium saßen die Historikerin Astrid Hirsch-von Borries (Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf), der Historiker Marcus Velke-Schmidt (Centrum Schwule Geschichte e.V.), der Künstler Christoph Westermeier (Künstlerverein Malkasten) und der Regisseur Marvin Wittiber (Theaterkollektiv DüsselDrama).
Am 15. Oktober 2021 wurde in prominenter Lage auf der Apollowiese zwischen Rheinkniebrücke und KIT der LSBTIQ+ Erinnerungsort Düsseldorf eröffnet und das „Seltsam klassische Denkmal“ von Künstler Claus Richter enthüllt. Es ist ein Ort für die Erinnerung und Akzeptanz von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Erinnert wird an die Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus, aber auch an die queere Emanzipationsbewegung seit den 1970er-Jahren. An der Realisierung dieses wichtigen Gedenkortes waren Astrid Hirsch-von Borries und Christoph Westermeier in vorderster Reihe beteiligt.
Beide konnten über die Herausforderungen bei diesem Projekt berichten. Christoph Westermeier war damals Mitglied der Kunstkommission, die für den Wettbewerb und die Umsetzung zuständig war. Er führte aus, welchen Diskurs es über die Ästhetik des Denkmals und seine inhaltliche Ausrichtung gegeben habe. Für die queere Community sei wichtig gewesen, nicht nur die Verfolgung schwuler Männer zu thematisieren, sondern auch die Verfolgung lesbischer Frauen und trans* Personen in den Blick zu rücken. Zudem sollte auch der Kampf für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung queerer Menschen in den Blick genommen werden, was mit dem Denkmal ausgesprochen gut gelungen sei, so Westermeier.

Astrid Hirsch-von Borries ist seit 2014 Mitarbeiterin der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf. Schon damals habe es in der Dauerausstellung ein Kapitel zur Verfolgung Homosexueller nach Paragraf 175 gegeben, die Beschäftigung mit diesem Themenbereich habe aber in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen. So wird in der aktuellen Dauerausstellung in der Gedenkstätte auf der Mühlenstraße an das Schicksal von Karl Carduck erinnert, der am 28. September 1937 wegen Verstößen gegen den Paragrafen 175 zu anderthalb Jahren Haft verurteilt wurde. Verhaftet wurden er und zahlreiche andere vermeintlich Homosexuelle von der Gestapo am 28. Juni 1937, dem Beginn einer beispiellosen Repression. Bis August 1938 verhaftete die Gestapo etwa 400 Männer wegen „homosexueller Handlungen“.
Damit war Düsseldorf die Stadt mit den meisten Festnahmen nach § 175 in ganz Westdeutschland. Um dies in Erinnerung zu halten, wird es nun auf Anregung von Astrid Hirsch-von Borries und in Zusammenarbeit mit dem LSBTIQ+ Forum Düsseldorf einen offiziellen „Düsseldorfer Gedenktag für die queeren Opfer des Nationalsozialismus“ am 28. Juni geben. Erstmals wird in diesem Jahr zu einer Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am LSBTIQ+ Erinnerungsort eingeladen. Im Anschluss findet im Beatrice-Strauss-Zentrum der Mahn- und Gedenkstätte eine Szenischen Lesung mit dem Titel „Allein im Rosa Winkel“ statt.

„Allein im Rosa Winkel“ ist ein Projekt des Theaterkollektivs DüsselDrama um Regisseur Marvin Wittiber. Der Düsseldorfer hat während eines Theaterworkshops mit Jugendlichen in Weimar auch die KZ-Gedenkstätte Buchenwald besucht und ist dort auf den Gedenkstein für die schwulen Opfer gestoßen. Ein einschneidendes Ereignis, wie Marvin erzählt. Zurück in Düsseldorf habe er erfahren, welches Ausmaß die Schwulenverfolgung hier gehabt hat, und sei betroffen gewesen, dass er als queerer Mann hiervon nichts gewusst habe. Grund genug, um ein Theaterprojekt mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ins Leben zu rufen, das sich genau hiermit beschäftigt.
Im vergangenen Jahr feierte „Allein im Rosa Winkel“ nach einem nur viertägigen Workshop Premiere im Theatermuseum. Das große Publikumsinteresse und die bevorstehende Programmreihe zur Erinnerung an 80 Jahre Befreiung und Kriegsende in Düsseldorf führten zu der Idee, auch die fortgeführte Verfolgung queerer Menschen in der Bundesrepublik zu thematisieren. Der neu konzipierte Theater-Workshop „Nach dem Rosa Winkel“ fand ebenfalls große Anerkennung, und so ist nun auch ein dritter Teil geplant, bei dem sich die Jugendlichen mit dem Leben queerer Menschen in den 1920er-Jahren auseinandersetzen werden.

Auch Christoph Westermeier, Vorsitzender des Künstlervereins Malkasten, hat sich künstlerisch mit dem Paragrafen 175 und seinen Folgen beschäftigt. Für ein aktuelles Projekt in München, zu dem der Düsseldorfer Künstler eingeladen wurde, forschte er beim Forum Queeres Archiv München und fand dort ein Konvolut der Zeitschrift „Zwischen den Andern“, die vom Publizisten Charles Grieger nach 1945 herausgegeben wurde. Er sei begeistert gewesen von den queeren Themen, die zu Zeiten der weiterhin bestehenden Repression behandelt wurden, und auch von der handkolorierten Ausgestaltung der Schreibmaschinenseiten. Für seine Arbeit und die Präsentation hat Westermeier Fragmente daraus fotografisch aufgenommen und in die Gegenwart transferiert. Zu sehen sind sie auf großformatigen Wänden im Münchner Luitpoldblock im Rahmen der dezentralen Ausstellung „Ein Haus ohne Mauern bauen“ bis zum 31. Mai 2025.

Der Historiker Markus Velke-Schmidt ist Vorsitzender des Vereins „Centrum Schwule Geschichte e.V.“ mit Sitz in Köln. Das CSG existiert seit 1984 und beschäftigt sich mit der Erforschung der Geschichte insbesondere homosexueller Männer in Köln und im Rheinland. Seit einigen Jahren erfolgt dabei eine zunehmende Öffnung hin zu queeren Themen und Fragestellungen. „Erfrischend anders“ sei die queere Erinnerungskultur in Düsseldorf, sagt er – auch mit Blick auf den LSBTIQ+ Erinnerungsort. „Gedenken zu queeren“ sei richtig, zugleich müsse aber auch „schwules und lesbisches Gedenken“ möglich sein.
Als Kurator verantwortet Markus Velke-Schmidt die Ausstellung „IM NAMEN DES VOLKES !? § 175 StGB im Wandel der Zeit“, die im Sommer 2020 schon in Düsseldorf zu sehen war und aktuell bis zum 1. Juni 2025 in der VHS Neuss gezeigt wird. Präsentiert wird die Geschichte antihomosexueller Gesetzgebung in Deutschland mit Fokus auf das Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalens. Dabei werden auch die Auswirkungen der Paragrafen auf lesbisches sowie trans- und intergeschlechtliches Leben in den Blick genommen.

Bei dem Podiumsgespräch wurde deutlich, dass Gedenken keine verstaubte Sache sein muss. Astrid Hirsch-von Borries formuliert es so: „Gedenken ist vielfältig und kann auch freudig sein“. So könne man ohne Weiteres nach der Gedenkfeier am 28. Juni zusammen zum Uerige laufen und dort gemeinsam ein Altbier trinken. Schließlich habe sich dort früher die Gaststätte „Vater Rhein“ befunden, ein Lokal, in dem damals die schwule Szene heimisch war und das als eines der ersten von den Nazis geschlossen wurde. Und Marvin Wittiber ergänzt: „Gedenken kann auch sein: gemeinsam Singen, Tanzen und Trinken – für die, die es nicht mehr können.“
Der nächste queere Talk findet am 20. August 2025 statt, dann zum Thema „Queerness und Migration – gestern und heute“.
Text: Oliver Erdmann