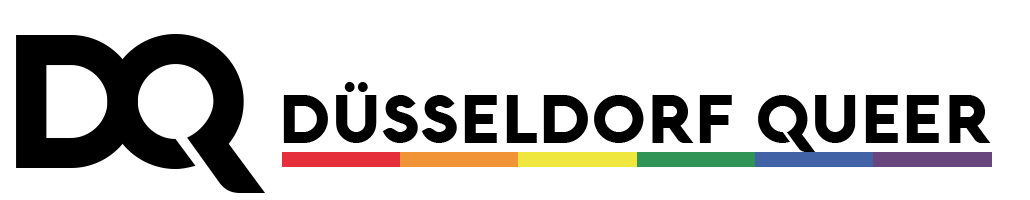„Queerness und Migration“ war das Thema beim siebten Podiumsgespräch in der Talkreihe „Queere Geschichte(n)“ im KAP1. Die Gäste von Moderator Sascha Förster erzählten ihre persönlichen Geschichten und gaben Einblicke in die Situation von queeren Menschen mit Migrationserfahrung.

Auch die siebte Veranstaltung in der Talkreihe „Queere Geschichte(n)“ war wieder gut besucht. Im Stadtfenster-Saal der Zentralbibliothek versammelten sich am 20. August 2025 über 50 Interessierte. Die Podiumsgespräche mit Moderator Dr. Sascha Förster (Institutsleiter TMD) werden veranstaltet von Queere Geschichte(n) Düsseldorf e.V. in Kooperation mit dem Amt für Gleichstellung und Antidiskriminierung, der Zentralbibliothek und dem Theatermuseum Düsseldorf.
„Queerness und Migration – gestern und heute“ lautete der Titel der Veranstaltung, doch Sascha Förster machte bereits zu Beginn deutlich, dass man sich eine Rückschau auf die Vergangenheit dieses Mal sparen wolle. Und so lag der Fokus des Gesprächs dann auch auf den persönlichen Geschichten der Gäste, von denen drei eine Migrations- oder Fluchterfahrung haben. Für den sehr guten und in großen Teilen bewegenden Talk gab es zum Abschluss viel Applaus vom Publikum.

Paul Gollenbusch (er) ist Verfahrensberater bei der Düsseldorfer Initiative „HISPI – Hilfe bei der sprachlichen Integration“. Seine Hauptaufgabe ist die Vorbereitung seiner Klient*innen auf die Anhörungen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und auf Gerichtverfahren. Seit 2015 ist Paul in der Flüchtlingsarbeit tätig. Er kennt das Hauptproblem für die meisten queeren Geflüchteten: Sie fliehen aus ihren Heimatländern, weil sie dort wegen ihrer Homo- oder Transsexualität verfolgt werden, und landen hier in Deutschland zusammen mit ihren Verfolgern in einer Unterkunft. Regelmäßig gibt es Berichte über Diskriminierung, Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen in den Einrichtungen.
In Düsseldorf haben es Paul und seine Mitstreiter*innen erreicht, dass es hier seit einigen Jahren speziellen Möglichkeiten zur Unterbringung queerer Geflüchteter gibt. In zwei städtischen Flüchtlingsunterkünften wurden geschützte Räume geschaffen mit separaten Duschen und direkter Anbindung zum Sicherheitspersonal. Und im neuen „House of Friends“, einem HISPI-Projekt, können vulnerable Personen untergebracht und ganzheitlich unterstützt werden; sie verwalten das Haus selbst und bekommen Hilfen bei der Integration.
Paul Gollenbusch hat zunächst als ehrenamtlicher Helfer in einer Landesunterkunft für Geflüchtete in Düsseldorf gearbeitet und dann eine Ausbildung zum Flüchtlingshelfer gemacht. Er kennt sich aus mit den Herausforderungen und Hürden, mit denen seine Klienten – zumeist sind es queere Männer – in den Asylverfahren zu kämpfen haben.

Aschah ist einer von Pauls Klienten. Der Iraner hat in seiner Heimat Biologie studiert und dort in einem HIV-Zentrum gearbeitet. Schon das erregte damals die Aufmerksamkeit der Behörden des totalitären Regimes. Eine HIV-Erkrankung gilt in der streng islamischen Gesellschaft als Schande, und homosexuelle Handlungen werden in Iran mit dem Tode bestraft. (Personalpronomen sind Aschah übrigens egal, da es auf Farsi, der persischen Sprache, keine geschlechtsspezifischen Pronomen gebe, wie er sagt.)
Um hier zu promovieren, kam Aschah im Jahr 2020 nach Deutschland. Wegen monatelanger Verzögerungen bei der Visumsvergabe konnte er seine Promotionsstelle aber nicht mehr antreten. Kurze Zeit nach seiner Ausreise nahmen die iranischen Behörden Ermittlungen auf und durchsuchten seinen Computer. Sie fanden eine E-Mail-Korrespondenz mit einer lesbischen Aktivistin, was schon für einen Spionage-Vorwurf ausreichte. Eine Rückkehr nach Iran ist ihm damit nicht mehr möglich. Er stellte in Deutschland seinen Asylantrag, der vom BAMF jedoch abgelehnt wurde. Den Mitarbeitenden des Bundeamtes erschien sein Asylgrund „Verfolgung wegen Homosexualität“ nicht glaubhaft, Aschah machte für sie nicht den Eindruck, ein schwuler Mann zu sein.
Seit fünf Jahren wartet Aschah nun auf sein Gerichtsverfahren. Ein unhaltbarer Zustand, findet auch Paul Gollenbusch, der Aschah seit 2022 in Düsseldorf betreut. Das BAMF wälze viele Entscheidungen auf die Gerichte ab, obwohl die meisten Fälle, in denen es um Verfolgung queerer Menschen geht, regelmäßig positiv beschieden würden, weiß er zu berichten. Die jahrelange Ungewissheit und eine drohende Abschiebung hingen wie ein Damoklesschwert über den Betroffenen. Integration, das Erlernen der deutschen Sprache und berufliche Weiterbildung bräuchten aber sichere Bleibeperspektiven, sagt Paul.

Lilith Raza (sie) stammt aus Pakistan und lebt seit 2012 in Köln. Auch sie kam für ihr Studium nach Deutschland. Nach ihrem Outing als trans* Frau war klar, dass es für sie keinen Weg mehr zurück in ihre Heimat gibt. In Pakistan wird Homosexualität mit Gefängnisstrafen bestraft; erst 2023 wurde ein Gleichstellungsgesetz für transgeschlechtliche Menschen von einem Sharia-Gericht aufgehoben. In Deutschland, berichtet Lilith, habe damals ein offenes Klima gegenüber Lesben, Schwulen und trans* Menschen geherrscht, doch das sei heute leider nicht mehr so, sagt sie. Auch in Köln habe sie Diskriminierungserfahrungen gemacht – damals wie heute –, doch der Kontakt zur queeren Community habe sie immer gestärkt. Sie fühlt sich mittlerweile hier zu Hause, seit sechs Jahren ist sie deutsche Staatsbürgerin.
Ihre Erfahrungen und ihr Wissen teilt Lilith nun mit anderen. Sie arbeitet beim LSVD+ Verband queere Vielfalt und betreut das Projekt „Queer Refugees Deutschland: Fluchtgrund queer“. In ihrem Job arbeitet sie in der Beratung für queere Geflüchtete, schult Personal in Behörden und Erstaufnahme-Einrichtungen sowie Integrations-Lehrkräfte und Dolmetscher*innen. Seit 2019 ist Lilith Raza Vorstandsmitglied beim Queeren Netzwerk NRW und setzt sich vehement dafür ein, dass queere Initiativen verlässlicher finanziert und nicht nur als Projekte gefördert werden.

Xeni Slay (dey/they) lebt seit drei Jahren in Düsseldorf. Geboren und aufgewachsen in der Ukraine, floh Xeni 2022 vor dem russischen Angriffskrieg zusammen mit der Mutter nach Deutschland. Der beschwerliche Fluchtweg führte die beiden über Polen und Berlin, von wo aus sie schließlich nach Düsseldorf kamen, weil hier bereits eine Freundin von Xenis Mutter wohnte. Am Anfang war alles „unfassbar schwer“, wie dey sagt, alles sei ein Problem gewesen, etwa das Leben in den Sammelunterkünften oder das Erlernen der deutschen Sprache parallel zur Bachelorarbeit. Doch in Düsseldorf fand Xeni schnell Freunde und eine „Chosen Family“, und hier konnte dey erstmals offen als nicht-binäre Person leben. Xeni entdeckte die Drag-Kultur als Form, um sich künstlerisch auszudrücken und organisiert seit einiger Zeit queere Events wie eine „Queer Open Stage“ oder „Beyond Borders“, einen Abend mit Drag-Performances und Live-Musik.
Hierfür gebe es nicht nur Anerkennung, sagt Xeni Slay. In der Ukraine heiße es oft: „Jetzt ist nicht die Zeit dafür.“ In Kriegszeiten könne man doch keine unterhaltsamen Events veranstalten oder sich für so etwas wie die Gleichstellung queerer Menschen engagieren. Vollkommen falsch, findet Xeni und wirbt auch innerhalb der ukrainischen Gemeinde in Düsseldorf für Toleranz und Akzeptanz.
Wer Xeni Slay auf der Bühne erleben möchte, hat demnächst die Gelegenheit dazu. Zusammen mit Drag Artist Marie Conna startet Xeni Slay den neuen Showabend „Spice it up!“ am 19. September mit den Gästen Ray und Barbie Q und am 20. September mit Baphometh und Barbie Q. Beide Shows finden im Theatermuseum Düsseldorf statt und beginnen um 19.30 Uhr.

Beim nächsten queeren Talk im KAP1 am 12. November 2025 geht es um „Queere Kultur – gestern und heute“.
Text: Oliver Erdmann